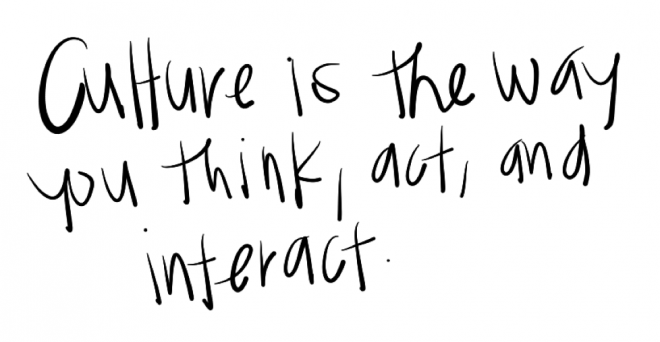Viele Unternehmen denken, sie wären agil, weil sie schnell und flexibel sind und außerdem agile Methoden einsetzen. Nur stimmt das so leider nicht bzw. reicht das nicht, um wirklich agil zu werden. Agilität ist vielmehr ein Mindset bzw. eine Geisteshaltung. Und wenn man an seiner Haltung nichts ändert, dann wird man halt auch nicht agil.
Agiles Mindset
Wenn eine Organisation weiterhin hierarchisch durchorganisiert ist, wenn Mitarbeiter weiterhin nichts selbstständig entscheiden dürfen, wenn man an Bürokratie und Sicherheit festhält – wenn also das Mindset nicht in Richtung agil angepasst wird – dann helfen auch agile Methoden nichts.
Leider ist dies bei vielen Unternehmen der Fall: Sie führen Scrum, Kanban oder Design Thinking ein, lassen aber alles andere beim Alten und verändern ihr althergebrachtes Denken nicht.
Agile Kultur
Die Unternehmenskultur muss sich agil anpassen, wenn man erfolgreich agil werden will. Mit dem Einsatz von agilen Methoden muss auch parallel an der Kultur gearbeitet werden, dh dass das Unternehmen eine andere Art der Führung braucht und dass sich Prozesse, Strukturen und Entscheidungswege verändern müssen.
Agile Methoden
Agile Methoden und agile Produktentwicklung haben 6 Grundlagen:
- Sie gehen vom Kunden aus und lösen dessen Probleme
- Sie zielen auf Geschwindigkeit ab
- Sie arbeiten mit Prototypen
- Sie schauen wie der Markt reagiert bevor das Produkt auf den Markt kommt
- Sie sind offen im Ausgang, aber haben ein klares Ziel
- Sie arbeiten iterativ
Agile Praxis
1. Kundenprobleme lösen
Werfen Sie Ihre vorgefassten Meinungen und Gedanken über Board und gehen Sie offen und frei an die Aufgabenstellung heran. Oft haben Unternehmen ein eigene Auffassung, was der Kunde möchte und wofür er zahlen würde. Binden Sie den Kunden so bald wie möglich ein und stellen ihm folgende Fragen:
- Was sind wirklich seine Bedürfnisse und Vorstellungen?
- Was fehlt ihm? Was stört ihn? Was nervt? Was braucht Zeit?
- Wie re/agiert er?
- Was nutzt er, was nicht?
- Was ist ihm wirklich wichtig, was nicht?
2. Die Welt wurde schnelllebiger
Google brauchte gerade mal 2 Wochen, um von der Idee einer Datenbrille zu einem unhübschen Prototypen zu gelangen. Es ist einfach old school, ein Produkt jahrelang zu entwickeln, um es erst dann “fertig” auf den Markt zu bringen. Wer nicht sofort mit der Idee auf den Markt kommt, wird entweder von jemanden überholt oder das fertige Produkt ist beim Release überholt, deshalb:
- Zu Beginn geht es nicht um Qualität, sondern um Originalität
- Es geht nicht um 100 % fertig zu sein, sondern darum, Ergebnisse möglichst schnell auf den Markt zu bringen
3. Minimaler Prototyp
Durch die Kundenorientierung und der Schnelligkeit ist die Entwicklung von Prototypen essentiell geworden. Die einfache, preiswerte und rasche Herstellung steht im Vordergrund. Also besser eine App haben, die zwar noch nicht alle Funktionen hat, aber dafür schon jene Buttons zeigt, die man den Kunden zeigen möchte. Dazu einfach die richtigen Fragen stellen (was ihm noch fehlt, wo sie was suchen würden, wie sie App verwenden würden).
- Zeigen Sie besser schon mal rasch ein schlechtes MVP (Minimum Viable Product, also die minimalste vorzeigbare Version eines Produktes) statt lange nur zu reden und zu überlegen, was man wann besser macht.
4. So tun als ob
Immer mehr Firmen verkaufen Produkte, die es so eigentlich noch gar nicht gibt – einfach nur um mal um online präsent zu sein und zu zeigen “Wir haben das Produkt”. Wenig überraschend, dass hier die US-Amis mal wieder bestes Beispiel sind und nur Fakes präsentieren, während im Hintergrund weiterentwickelt wird – getreu dem Motto “Fake it until you make it”.
Tesla verkauft Autos, die sie noch gar nicht hergestellt haben, einfach mal um zu schauen, wie der Markt reagiert und was beim Kunden ankommt – Hauptsache eben mal erster sein.
5. Offene Produktentwicklung
Bisher war es üblich, eine Produktentwicklung basierend auf einer Idee auszuarbeiten, einen Business- und Budgetplan zu erstellen, einen Projektplan zu entwickeln und das Produkt zu erarbeiten.
Heutzutage ist aber üblich, eine Produktentwicklung basierend auf einer groben Idee und mit offenem Ausgang und ohne klarem Ziel zu starten. Dafür werden nach jedem Arbeitsschritt die Ergebnisse mit dem Kunden abgeglichen.
Nur so kann man den ständig wandelnden Kunden-Bedürfnissen und der schnelllebigen Zeit gerecht werden – und verzichtet darauf, über einen längeren Zeitraum in die falsche Richtung zu investieren.